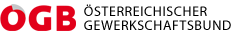Aktuelle Folge
Einkommen
Streik oder Verhandlungstisch? Kollektivvertrag oder gesetzlicher Mindestlohn? Inflationsabgeltung oder Anteile am Produktivitätswachstum? Gleicher Lohn oder Gender Pay Gap? Und was haben unbezahlte Arbeit und eine Arbeitszeitverkürzung mit all dem zu tun?
Die Einkommen werden in Österreich nicht etwa automatisch an die Inflation angepasst – sie sind Verhandlungssache. Welche Rolle spielt dabei die Sozialpartnerschaft? Was ist die Benya-Formel? Welche Einkommensgruppen entwickeln sich gut, welche schlecht?
98 Prozent der unselbständigen Arbeitsverhältnisse werden in Österreich von Kollektivverträgen abgedeckt. Warum bekommt gerade der Metaller-KV jedes Jahr so große Aufmerksamkeit – und wieso sehen Industrielle im Herbst meist eine düstere Zukunft für die eigene Branche voraus? Brauchen wir eigentlich einen gesetzlichen Mindestlohn wie in Deutschland? Und was hat die Pflichtmitgliedschaft der Wirtschaftskammer damit zu tun?
Darüber und vieles mehr spricht Michael Mazohl mit der Ökonomin und Referentin der Frauenabteilung Katharina Mader von der Arbeiterkammer Wien. Einen ausführlichen Blick werfen die beiden auf den Gender Pay Gap. Natascha Strobl räumt mit einem Märchen aus: dem Leistungsmythos.
Mehr zum Thema „Einkommen“ im Klassenkampf schreiben die Autor*innen in ihrem Buch.
Klassenkampf von oben
Angriffspunkte, Hintergründe und rhetorische Tricks
von Natascha Strobl und Michael Mazohl
https://shop.oegbverlag.at/catalog/product/view/id/137385/s/klassenkampf-von-oben-9783990464649/
Der Podcast zum Buch entsteht in Kooperation mit dem Magazin Arbeit&Wirtschaft.
Folge direkt herunterladen